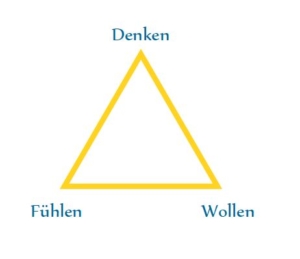Die Aktualität von Yoga für unsere Kultur – Teil 2
Dieser Teil des Artikels baut auf Teil 1 auf und ist nur im Zusammenhang verständlich.
von Bernd Klane und Ursula Klane 03/2024, überarbeitet 01/2025
Aus dem raja-yoga wollen wir aus den yama den Aspekt ahimsa herausgreifen. Ahimsa bedeutet übersetzt Streben nach Gewaltlosigkeit. Die yama, die übergeordneten Lebensgesetze, sind einerseits als Ideale und andererseits als Ergebnisse einer eigenständigen Auseinandersetzung zu verstehen, so eben auch ahimsa.
Die Größe, die Umfänglichkeit eines solchen yama oder Gesetzes ist regelrecht universal oder menschheitsumspannend. Ahimsa auf einem oder gar mehreren Gebieten des Lebens, in Situationen des Lebens selber zu gestalten – und nichts geringeres könnte das Ziel sein oder werden- erscheint sehr anspruchsvoll.
Der Aspirant des Yoga bemerkt mit einiger Übung, dass es für eine erste reale Einschätzung von ahimsa noch nicht ausreicht, tätliche Gewalt zu vermeiden. Für unser alltägliches Verständnis in Hinblick auf Gewaltlosigkeit bezieht sich diese häufig zunächst auf äußere Handlungen aller Art. Eine Nichtanwendung von tätlicher Gewalt ist im Rechtsstaat anerkannt und gesetzlich verankert. Die nachweisbare tätliche Gewalt gegenüber Dritten ist u.U. strafbar.
Auch die Vermeidung psychischer Gewalt ist in unserer Gesellschaft angestrebt und in ständiger Weiterentwicklung begriffen, was ebenfalls wichtig und positiv einzuschätzen ist. Wissenschaftliche Fachrichtungen wie Psychologie, Pädagogik und Kommunikationswissenschaft beschäftigen sich mit Gewalt und ihrer Vermeidung. In der Sprache und in der Kommunikation findet man vielfältige Ansätze und Bemühungen, wie Gewalt in psychischer Hinsicht erkannt und mit ihr umgegangen werden kann. Viele rhetorische Maßnahmen und Techniken beschäftigen sich beispielsweise mit Deeskalation und Konfliktmanagement.
Die Erweiterung des Weltbildes durch Yoga
Wie begegnen sich Yogawissenschaft und unser neuzeitliches wissenschaftliches Weltbild? Dazu wollen wir uns folgendes Bild vorstellen:
Stellen Sie sich das Lebensgefühl von Menschen an einem Ort der Erde vor, der konstant unter einer geschlossenen Wolkendecke, die auf niedriger Höhe in der Atmosphäre verharrt, liegt. An diesem Ort hat man also nie blauen Himmel, die Sonne und nachts Sterne gesehen und auch nicht die Weite des nächtlichen Sternenmeers erlebt. Wörtern wie „Himmel“, „Sonne“, „Stern“ oder „Kosmos“ kommt an diesem Ort folglich keine reale, erlebbare Bedeutung zu. Diese Lebensbedingung führt zu einem spezifischen Lebensgefühl und zu einem eingeschränkten Bild über das Dasein. Die Frage, ob der Wolkenschirm sich nach oben unendlich fortsetzt oder ob dies nur eine Schicht ist, über der etwas vollkommen Andersartiges liegt, mag den meisten Menschen bedeutungslos erscheinen und außerdem vom Boden aus überhaupt nicht lösbar zu sein. Der Aufstieg auf einen hohen Berg könnte vielleicht den Blick über die Wolkendecke freigeben und die Zuordnung von Wolkendecke, freier Atmosphäre, Sonne und Sternen ermöglichen und damit das eigene Weltbild erweitern. Da Yoga, bildhaft gesprochen, von der Existenz des freien und weiten Raums oberhalb der Wolken weiß, ermutigt er den Menschen sinngemäß zu dieser großen Bergbesteigung und gibt konkrete Anweisungen und Empfehlungen für dessen Aufstieg. Ein erstes Ziel ist es, dem Einzelnen die richtigen Zuordnungen zwischen dem Leben am Boden und der weiten Sicht aus unterschiedlichen Berghöhen durch ein Wolkenloch oder gar am Gipfel die Freisicht über den Wolkenschirm zu ermöglichen.
Im Gegensatz dazu befassen sich z.B. Wissenschaften wie Pädagogik oder Psychologie tendentiell mit dem Zurechtkommen in der Abgeschlossenheit unter der Bewölkung – was eine Berechtigung und seinen Stellenwert hat.
Wer sich von dem Bild der freien Atmosphäre und der Weite des Kosmos angesprochen fühlt, findet in jedem großen Yogapfad, so auch im raja-yoga, Anleitung. Zur eigenaktiven Entwicklung muss der Aspirant mit Zeit, Ruhe und Wiederholung spirituelle Schriften zur Kenntnis nehmen, und erste Ahnungen und beginnende Erkenntnisse im täglichen Leben beobachten und verifizieren lernen. Auf diese Weise tastet er sich an Erkenntnisse zu den inneren Hierarchien des Lebens, im obigen Bild die Weite des Alls, langsam heran.
Diese vielseitige, kreative, disziplinierte und stetige Arbeit eröffnet ihm mit Zeit, Geduld und Fleiß neue Möglichkeiten. Diese können sich beispielsweise in weiterführenden Gedanken zum jeweiligen Thema, in Ideen, in lebenspraktischen Zielen und erweiterten Fähigkeiten zeigen.
Ahimsa in Sprache und Kommunikation
Um ein Beispiel für den Alltag zu geben, möchten wir dieses umfassende Gesetz ahimsa für eine Erweiterung in Kommunikation und Sprache aufgreifen.
Das Beispiel Kommunikation und Sprache wählen wir, da jeder Erwachsene täglich je nach Situation mündlich und schriftlich kommuniziert. Gleich, ob wir noch berufstätig sind oder bereits in fortgeschrittenem Alter, Sprache und Kommunikation begleiten uns in der direkten und schriftlichen Begegnung, in jeder Art von Mediennutzung.
Durch die Auseinandersetzung mit Yoga kann es sein, dass der sich Übende seine Befähigungen in der Kommunikation, in der Gewandtheit mit Situationen umzugehen, weiterentwickelt. Sein bisher angelegtes und ausgeprägtes Sprachvermögen sind demgegenüber untergeordnet, denn durch diese erweiterte Übungspraxis denkt und fühlt sich der Übende vergleichsweise umfassender in Sprache und in die Begegnung mit anderen ein.
Die Auseinandersetzung mit Gewaltlosigkeit in der Kommunikation durch Yoga geht über methodisches Vorgehen, psychologische Forschung und Handlungsempfehlungen weit hinaus.
Ein Ideal für die Kommunikation
Folgendes Ideal soll uns bei dem nachfolgenden Beispiel leiten:
Eine Sprache, die ein Thema möglichst objektiv oder wirklichkeitsgemäß heranführen will und und sich um eine beschreibende Darstellung bemüht, wirkt tendentiell freilassend auf alle Beteiligten und vermittelt zwischen dem Gesprächsgegenstand und den Anwesenden. Sie lässt Empfindungen, das sind tiefe seelische Regungen, entstehen. Empfindungen wirken auf die gesamte Umwelt heilsam zurück.
Ein Kommunikationsbeispiel
Stellen Sie sich folgende Situation vor : Drei Personen unterhalten sich über Erlebnisse einer Autofahrt in den Alpen, von Landeck kommend Richtung Süden durchs Oberinntal zum Reschenpass und weiter über Reschensee, Haidersee ins Vinschgau und ins Trentin. Zwei Personen kennen die Fahrstrecke, die dritte Person nicht.
Im Laufe des Gesprächs sagt eine Person, der Streckenabschnitt südlich vom Haidersee, südlich vom Weiler Fischerhäuser und dem tiefer gelegenen Ort Mals im oberen Vinschgau (ein großer Bereich der sog. Malser Haide) wäre fürchterlich, und außerdem eine grässliche Rennstrecke. Es wäre regelrecht eine Zumutung, diese Straße fahren zu müssen. Die andere Person entgegnet, sie fände es wäre eine herrliche Strecke mit toller Landschaft und unglaublicher Aussicht, einfach wunderbar.
Die dritte Person, die die Fahrstrecke nicht kennt, hört die gegensätzlichen Einschätzungen und Ansichten. Sie kann sich aber von dem Streckenabschnitt der Malser Haide durch das Gespräch keine eigene Vorstellung machen. Statt dessen nimmt sie an den Emotionen der Sprechenden teil, und je nach Gesprächsführung nimmt sie diese mehr oder weniger stark in sich auf. Vielleicht neigt die dritte Person sogar dazu, sich entweder mehr dem einen oder dem anderen Gesprächspartner emotional anzuschließen. Damit würde sie ohne Realitätsbezug demjenigen folgen, der als „Wortführer“ imposanter oder zumindest emotional überzeugender auf sie wirkt.
Wie anders wäre es, wenn eine der beiden Kenner der Strecke diese etwa so darstellen würde:
„Wenn man von Norden, vom Reschensee und anschließend vom Haidersee weiter nach Süden fährt, beginnt die Abfahrt ins obere Vinschgau von knapp 1.500 Hm bergab bis auf 1.000 Hm bei Mals. Südlich vom Weiler Fischerhäuser zieht die Straße einige hundert Meter nach Süden, um mit der beginnenden Abfahrt in mäßiger Neigung die Malser Haide von NW nach SO mehr oder weniger kilometerbreit zu queren, und wie bei Passstraßen in Haarnadelkurven zu wenden. Diese lang gezogenen, gut ausgebauten Straßen ermöglichen eine entspannte Fahrt.
An den Hängen der Malser Haide stehen Felder und überwiegend Wiesen, einzelne Bäume wachsen entlang der Straße. So hat man je nach Fahrtrichtung einen weiten Blick in unterschiedliche Berg- und Tallandschaften, insbesondere auch zum vergletscherten Ortlergebirge. Im unteren Bereich der Straße wenige Kilometer vor Mals endet die Ausbaustrecke und die Straße wird schmal, abschüssig und leicht kurvig. Mit der Ankunft bei Mals hat man einen deutlichen Anteil der Malser Haide gequert.
Ich empfinde diese Fahrt als Übergang aus einer beengenden Passlandschaft mit steilen Berghängen in die Weite der offenen Tallandschaft mit erhebendem Panorama. Deshalb erlebe ich die Fahrt vom Reschen ins obere Vinschgau als schön.“
Wenn eine der Personen, die die Fahrt kennen, den Straßenabschnitt in der Form beschreibt, bekommt die dritte Person einen ersten konkreten Eindruck der Fahrt über die Malser Haide. Sie erfährt ein paar Details, und kann es infolgedessen sogar interessant finden, die Strecke selber einmal abzufahren.
Der Unterschied von Empfindungen zu Emotionen
Betrachten wir anlässlich des Beispiels den Unterschied von Emotionen und Empfindungen noch einmal genauer.
Schöne Emotionen wie auch negativ besetzte Emotionen tragen wie ersichtlich keine sachbezogene Aussage in sich. Die dritte Person, die die Wegstrecke nicht kennt, verbleibt in den Äußerungen wie „fürchterlich“, „grässliche Rennstrecke“, „regelrechte Zumutung“, und andererseits „tolle Landschaft“, „unglaubliche Aussicht“, „einfach wunderbar“, „herrliche Strecke“. Sie kann sich vielleicht aus Begriffen wie „Rennstrecke“ oder „Aussicht“ selber etwas zusammenreimen, bekommt aber keine zusammenhängende Vorstellung von der Fahrt über die Malser Haide. Emotionen transportieren alle möglichen Gemütszustände, sie können im Positiven sentimental sein oder überschwänglich, im Negativen z.B. Aggressionen vermitteln. Jede Art Emotion, so auch Sentimentalität oder Überschwang führen den Menschen von einer realen und objektiven Wahrnehmung hinweg. Es entsteht ein Mangel an Konkretheit und Sachbezug. Anhand der Emotion heischt der Sprecher (oder Autor eines Textes) mehr oder weniger bewusst um Aufmerksamkeit oder gar um Zustimmung. Emotionen tragen bei exakter Beobachtung eine unterschiedlich aufregende, manchmal sogar aufpeitschende Wirkung in sich.
Infolgedessen lässt sich sagen, dass Emotionen alle Gesprächsbeteiligten tendentiell wie gefangen nehmen oder anders formuliert, Emotionen alle Gesprächsbeteiligten in eine meist ungesehene und unbeabsichtigte Abhängigkeit führen. Im Ergebnis wirken sich Emotionen trennend auf alle Beteiligten aus. Häufig nehmen Menschen irrtümlich jedoch das genaue Gegenteil an, nämlich dass sie sich untereinander durch schöne Emotionen verbinden würden und dass fehlende Emotionalität ein Mangel an menschlicher Wärme darstellen würde – eine fatale Fehleinschätzung aus dem Blickwinkel des Yoga.
Empfindungen dagegen entstehen ganz allgemein aus der inneren Nähe und Wahrnehmung zum Gegenüber, beispielsweise zu einem einfachen Gesprächsgegenstand wie hier dem der Wegstrecke, zu einer Naturerscheinung, einem Arbeitsvorgang oder einem anderen Menschen. Grundsätzlich wird wohl jeder Gesprächsbeteiligte ein Empfinden zu einem Gesprächsgegenstand in andere Worte kleiden, aber dieser wäre für alle erkennbar und erlebbar, wenn Empfindungen beschrieben werden. Es wäre deshalb erlebbar, weil sich durch die Empfindung eine wahre Aussage zum Gesprächsgegenstand mitteilt. Damit eröffnen Empfindungen einen weiten Erlebensraum, an dem jeder Anwesende teilnimmt und außerdem weiter anknüpfen kann. Zusätzliche Möglichkeiten entstehen in der Folge wie z.B. Freude, Interesse, lebenspraktisches Denken, Erweiterung von Fähigkeiten und eine reale Verbindung untereinander als auch zum Gesprächsgegenstand.
Aus gesundheitlicher Sicht wirkt das Pflegen von Empfindungen zentrierend und sammelnd auf den Menschen, weil er rasche Eindrücke zu einem Empfinden und tieferen Erleben weitergeführt hat. Er erlebt sich schließlich ruhig und konzentriert.
Sowohl Emotionen, die den einzelnen auf seine Innenwelt zurückwerfen als auch Empfindungen, in welchen die Außenwelt sich real in uns ausdrückt, gehören dem seelischen Bereich des Menschen und des Lebens an. Im Bereich des Seelischen bleiben weder die negativen Wirkungen von Emotionen noch die positiven Wirkungen von Empfindungen auf den jeweiligen Gesprächskreis beschränkt, sondern tragen sich weit in die Umwelt hinaus.
Das Beispiel der Fahrstrecke ist deshalb gewählt, da es einfach verständlich ist und eine vergleichsweise belanglose, alltägliche Begebenheit wiedergibt. Außerdem erweckt das Gespräch über eine Fahrstrecke und die unterschiedlichen dargestellten Meinungen und Emotionen vermutlich kaum Regungen oder Parteiungen beim Leser. Im Gespräch über zeitaktuelle Ereignisse hingegen erhitzen sich schnell die Gemüter, es können emotionale Diskussionen entstehen. An derartigen Gesprächsbeispielen wäre es weit schwieriger zu übermitteln, wie eine beschreibende Sprache im Gegensatz zu einer emotionsreichen wirkt. Die Bedeutung und Aktualität dieses Artikels wird insbesondere dann erkennbar, wenn der Leser anspruchsvollere Gesprächssituationen unter diesem Aspekt von ahimsa beleuchten lernt.
Der wahre Gedanke beschreibt die menschheitsumspannende Realität
Heinz Grill, Geistforscher, Autor und Yogalehrer der Gegenwart beschreibt diesen Aspekt von ahimsa in der Kommunikation in einer seiner Ausführungen folgendermaßen:
„…Durch die Art des Redens können wir anderen Menschen eine heimliche Gewalt zufügen und wir können ihnen eine fremdartige astrale (astral: Fachbegriff eines ganzheitlichen Menschenbildes) Stimmung aufdrücken. Der Unterschied von aufdringlichen, manipulativen, zwingenden oder affektvollen Worten zu wirklichem bewussten Dialog und beschreibenden Darstellungen ist etwa so groß, wie wenn wir einen Menschen schlagen und erniedrigen, oder im Gegensatz dazu, ihn achten und in Ehren halten*. ….“
Durch das Studium bei Heinz Grill kann der Interessent einen tiefen Zugang zu den Kernanliegen des raja-yoga in seiner Zeitaktualität finden.
*Zitat von Heinz Grill aus dem Buch: Initiatorische Schulung in Arco – Die Seelsorge für die Verstorbenen; ISBN 3-935925-68-9